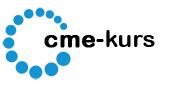Einleitung
Kardiovaskuläre Erkrankungen (CVD) sind weltweit die führende Todesursache. Im Jahr 2022 verstarben schätzungsweise 19,8 Millionen Menschen an CVD, was etwa 32 % aller Todesfälle weltweit entspricht. Rund 85 % dieser Todesfälle waren auf Herzinfarkt oder Schlaganfall zurückzuführen. Mehr als drei Viertel aller CVD-bedingten Todesfälle treten in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen auf. Von den 18 Millionen vorzeitigen Todesfällen (<70 Jahren) aufgrund nicht übertragbarer Krankheiten im Jahr 2021 waren mindestens 38 % auf CVD zurückzuführen. Laut dem Bericht der World Heart Federation von 2023 ist die Zahl der Todesfälle durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen weltweit von 12,1 Millionen im Jahr 1990 auf 20,5 Millionen im Jahr 2021 gestiegen. Die meisten Herz-Kreislauf-Erkrankungen lassen sich durch die Reduktion bzw. Beseitigung verhaltensbedingter und umweltbedingter Risikofaktoren – wie zum Beispiel Tabakkonsum – verhindern. Der Verzicht auf Rauchen führt zu einer schnellen und deutlichen Verringerung des kardiovaskulären Risikos. Diese Zahlen betonen die besondere Bedeutung von CVD für die Volksgesundheit und die Wichtigkeit einer effektiven Prävention und Therapie. Die meisten kardiovaskulären Erkrankungen sind grundsätzlich vermeidbar, insbesondere durch eine gezielte Reduktion von Risikofaktoren sowie durch die Veränderung gesundheitsbeeinträchtigender Lebensumstände. Zu den relevanten Risikofaktoren zählen Tabakkonsum, ungesunde Ernährung, Adipositas, Diabetes mellitus, Luftverschmutzung, Bewegungsmangel, schädlicher Alkoholkonsum und soziale Benachteiligung. Ist eine kardiovaskuläre Erkrankung bereits entstanden, ist eine möglichst frühzeitige Diagnose entscheidend, um Schäden durch geeignete Beratung und medikamentöse Therapie wirksam zu begrenzen.
Die Bedeutung der koronaren Herzkrankheit (KHK)
Die koronare Herzkrankheit (KHK) stellt die klinisch bedeutsame Manifestation der Atherosklerose an den Koronararterien dar und verläuft in der Regel progredient. Sie führt häufig zu einem Missverhältnis zwischen dem Sauerstoffbedarf und dem Sauerstoffangebot im Myokard. Die KHK ist mit einem erhöhten Risiko für Morbidität und Mortalität assoziiert und äußert sich typischerweise in Form von Angina pectoris. Laut dem aktuellen Deutschen Herzbericht 2024 war die chronische KHK auch im Jahr 2022 wie bereits in den Vorjahren die häufigste Todesursache: An einer chronischen ischämischen Herzkrankheit verstarben 77.773 Menschen, was 7,3 % aller Todesfälle entspricht. Der akute Myokardinfarkt war im selben Jahr für 46.608 Todesfälle verantwortlich, entsprechend einem Anteil von 4,4 %. Männer erleiden in Deutschland häufiger einen Myokardinfarkt als Frauen und sterben auch häufiger daran. Nach aktuellen Statistiken ist die Hospitalisierungsrate bei akutem Myokardinfarkt bei Männern mit etwa 311,5 Fällen je 100.000 Einwohner mehr als doppelt so hoch wie bei Frauen (143 je 100.000). Die Leitlinien der European Society of Cardiology (ESC) von 2021 zur Prävention kardiovaskulärer Erkrankungen nehmen Stellung zur Prävention der KHK. Als wichtigste Risikofaktoren für KHK gelten Dyslipidämie, arterielle Hypertonie, Zigarettenrauchen, Diabetes mellitus und Adipositas. Die Modifikation von Risikofaktoren sollte individuell angepasst und schrittweise erfolgen. Eine regelmäßige körperliche Aktivität ist eine zentrale Säule der Prävention. Der Rauchverzicht führt zu einem rapiden Absinken des kardiovaskulären Risikos und gilt als kostengünstigste Präventionsmaßnahme. Eine kritische medikamentös einstellbare Zielgröße ist der Low Density Lipoprotein-Cholesterin-(LDL-C-)Wert. Je niedriger der Wert ist, desto größer ist der Schutz vor kardiovaskulären Erkrankungen. Dabei gelten sowohl der absolute LDL-C-Spiegel als auch die Gesamtexpositionsdauer gegenüber erhöhten LDL-C-Spiegeln als bedeutsam. Als medikamentöse Optionen stehen Statine, Ezetimib und ggf. PCSK9-Inhibitoren zur Verfügung. Zudem gilt die Einstellung des arteriellen Blutdruckes auf Normwerte als kritische präventive Maßnahme. Darüber hinaus ist die Behandlung häufiger Komorbiditäten wie Diabetes mellitus, chronischer Nierenerkrankung und psychischer Erkrankungen von großer Bedeutung.
Diagnostik der KHK
Leitsymptom der KHK ist die Angina pectoris. Eine typische Angina liegt vor, wenn alle drei der folgenden Merkmale erfüllt sind: retrosternale Beschwerden von kurzer Dauer, Auslösung durch körperliche oder psychische Belastung sowie Besserung in Ruhe oder nach Nitratgabe innerhalb weniger Minuten. Ausgangspunkt (differenzial-)diagnostischer Überlegungen in der Primärversorgung ist in der Regel ein Brustschmerz. Bei etwa 8 bis 11 % der Patienten, die sich mit diesem Leitsymptom in der hausärztlichen Praxis vorstellen, liegt eine chronische KHK zugrunde. Das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf eine stabile stenosierende Form der Erkrankung sollte gemäß der S3-Leitlinie „Nationale VersorgungsLeitlinie Chronische KHK” aus dem Jahr 2024 erfolgen. Im Rahmen der hausärztlichen Abklärung von Brustschmerzen sollen anamnestische, körperliche, psychologische und soziale Informationen frühzeitig erhoben werden, um einer vorschnellen Fixierung auf rein somatische Ursachen vorzubeugen. Bei allen Patienten mit Brustschmerz sollte die klinische Wahrscheinlichkeit für eine stenosierende Ursache eingeschätzt werden. Hierzu empfiehlt die aktuelle Leitlinie den Einsatz klinischer Kriterien, die je nach Vorliegen für oder gegen eine kardiale Genese sprechen. Wichtige anamnestische Hinweise, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sind unter anderem: Alter (Männer ≥55 Jahre, Frauen ≥65 Jahre), bekannte vaskuläre Vorerkrankungen, belastungsabhängige Beschwerden, nicht reproduzierbare Schmerzen bei Palpation, retrosternales Druckgefühl sowie die subjektive Einschätzung von dem Patienten oder Hausarzt, dass eine ernste oder kardiale Ursache vorliegt. Zur strukturierten Ersteinschätzung in der hausärztlichen Versorgung empfiehlt sich der Marburger Herz-Score. Dieser berücksichtigt die folgenden Parameter: Alter, Geschlecht, bekannte vaskuläre Erkrankung, belastungsabhängige Beschwerden, nicht reproduzierbare Schmerzen durch Palpation sowie subjektive Vermutung einer kardialen Ursache und ermöglicht anhand der Punktzahl eine Risikostratifizierung:
- 0 bis 2 Punkte: <2,5 % Wahrscheinlichkeit
- 3 Punkte: ca. 17 %
- 4 bis 5 Punkte: ca. 50 %
Bei geringer klinischer Wahrscheinlichkeit (Score ≤2) soll keine weiterführende Diagnostik erfolgen. Besteht hingegen aufgrund von Anamnese und klinischem Eindruck der Verdacht auf eine stenosierende Ursache, sollen ein Ruhe-EKG mit zwölf Ableitungen sowie eine Echokardiografie im Ruhezustand durchgeführt werden. Liegt eine mittlere Vortestwahrscheinlichkeit (15 bis 85 %) vor, wird der Einsatz nicht invasiver bildgebender Verfahren empfohlen, um die Diagnose weiter einzugrenzen. Die Wahl des jeweiligen Verfahrens sollte individuell erfolgen und hängt ab von
- der geschätzten Vortestwahrscheinlichkeit,
- der körperlichen Eignung der Patientin oder des Patienten für das Verfahren,
- dem prognostischen Informationsbedarf,
- den möglichen Risiken des Tests sowie
- den verfügbaren Ressourcen und der lokalen Expertise.
Bei einer Vortestwahrscheinlichkeit bis 50 % soll vorrangig eine Koronar-CT durchgeführt werden. Liegt die Vortestwahrscheinlichkeit >85 %, kann eine stenosierende Genese als wahrscheinlich angenommen und ohne weitere Diagnostik direkt eine Therapieplanung eingeleitet werden.
Kontrolle des arteriellen Blutdruckes
Eine langjährig bestehende arterielle Hypertonie führt zu Organschäden und begünstigt die Entstehung kardiovaskulärer, zerebrovaskulärer und klinisch manifester Nierenerkrankungen. Diese Folgeerkrankungen zählen zu den wesentlichen Treibern der weltweiten Krankheitslast chronischer Erkrankungen. Trotz jahrzehntelanger Erkenntnisse über die gesundheitlichen Risiken der arteriellen Hypertonie und das Vorhandensein wirksamer medikamentöser Therapieoptionen bleibt sie weltweit der führende modifizierbare Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und trägt maßgeblich zur globalen Morbidität und Mortalität bei. Die aktuelle Leitlinie der European Society of Cardiology (ESC) von 2024 empfiehlt den Einsatz außerklinischer Blutdruckmessungen zur Diagnostik und Verlaufskontrolle der arteriellen Hypertonie. Diese Empfehlung basiert auf zunehmender Evidenz, die eine stärkere Assoziation von Heim- und 24-Stunden-Blutdruckmessungen mit kardiovaskulären Endpunkten zeigt. Zur Diagnosebestätigung empfiehlt die Leitlinie entweder eine ambulante Langzeitblutdruckmessung („ambulatory blood pressure monitoring”, ABPM) oder systematische Heimblutdruckmessungen („home blood pressure monitoring”, HBPM). Diese außerklinischen Messverfahren ermöglichen nicht nur die Erkennung von Weißkittel- und maskierter Hypertonie, sondern erlauben auch eine präzisere Beurteilung des durchschnittlichen Blutdruckes und damit des blutdruckbedingten kardiovaskulären Risikos. Im Einklang mit dem aktualisierten Verständnis richtet die Leitlinie der ESC von 2024 den Fokus nicht mehr ausschließlich auf die absoluten Blutdruckwerte, sondern betont vorrangig die Senkung des gesamten kardiovaskulären Risikos. Dieser Paradigmenwechsel spiegelt sich unter anderem in der Einführung einer neuen Kategorie „erhöhter Blutdruck” wider, die eine differenziertere Risikoabschätzung und individuellere Therapieentscheidungen ermöglicht. Die Definition der arteriellen Hypertonie sowie der bekannte Grenzwert von 140/90 mmHg bleiben in der aktuellen ESC-Leitlinie unverändert und entsprechen den Angaben der European Society of Hypertension (ESH) sowie der Nationalen VersorgungsLeitlinie Hypertonie von 2023. Die Einteilung der Hypertonie in die Grade I, II und III wird in der Leitlinie nicht mehr explizit genannt, jedoch sind die bekannten Schwellenwerte von 140/90, 160/100 und 180/110 mmHg weiterhin im Diagnosealgorithmus enthalten, um die Dringlichkeit von Diagnostik und Therapie einzuschätzen. Eine zentrale Neuerung ist die Einführung der Kategorie „erhöhter Blutdruck”, definiert als Praxisblutdruckwerte von 120–139 zu 70–89 mmHg. Werte unterhalb dieses Bereiches gelten als „nicht erhöhter Blutdruck”, Werte darüber als Bluthochdruck. Damit wird berücksichtigt, dass bei hohem kardiovaskulären Risiko (CVR) durch die Senkung eines bereits erhöhten Blutdruckes das Risiko für akute kardiovaskuläre Ereignisse reduziert werden kann. Folglich wird bei Patienten mit erhöhtem Blutdruck eine stufenweise Abschätzung des gesamten CVR empfohlen, welches maßgeblich die weiteren Therapieempfehlungen bestimmt. Bei allen Betroffenen mit erhöhtem Blutdruck sind Lebensstilmaßnahmen zur Blutdruck- und Risikoreduktion indiziert. Liegen Begleiterkrankungen wie koronare Herzkrankheit, Herzinsuffizienz oder Schlaganfall vor oder besteht ein insgesamt erhöhtes CVR, soll nach drei Monaten eine erneute Blutdruckkontrolle erfolgen. Bei weiterhin erhöhtem Blutdruck im Bereich von 130–139 zu 80–89 mmHg wird in diesen Gruppen ergänzend eine antihypertensive medikamentöse Behandlung empfohlen. Der hohe prognostische Nutzen einer Blutdrucksenkung bei Hypertoniepatienten ist in vielen Studien dokumentiert worden. In einer Meta analyse von 61 prospektiven Studien korrelierte eine Senkung des systolischen Blutdruckes um 20 mmHg mit einer zweifach niedrigeren Sterberate sowohl aufgrund einer ischämischen Herzerkrankung als auch von Schlaganfällen. Eine ganz ähnliche Risikoreduktion wurde bei einer Senkung des diastolischen Blutdruckes um 10 mmHg beobachtet. Seit 1998 gibt es in Deutschland große Fortschritte bei der Hochdrucktherapie. Zum damaligen Zeitpunkt wussten nur 69 % der Hypertoniker von ihrer Erkrankung, 55 % wurden behandelt, und bei 23 % wurde der Blutdruck kontrolliert. Im Zeitraum 2008 bis 2011 hatte sich die Situation bereits deutlich verbessert: 82 % der Betroffenen wussten, dass sie Bluthochdruck hatten, 72 % wurden behandelt, und bei 51% wurde der Blutdruck kontrolliert.
Zielwerte für den Blutdruck
Angesichts üblicher Blutdruckschwankungen von 5–10 mmHg, bedingt durch Unterschiede in Messmethodik und -umgebung (z. B. Studienbedingungen vs. Alltag, Praxis- vs. Heimblutdruck), empfiehlt die ESC-Leitlinie anstelle eines festen Zielwertes einen Zielkorridor von 120–129 mmHg systolisch und 70–79 mmHg diastolisch. Dieser Korridor soll die praktische Umsetzung erleichtern und gilt, bei guter Verträglichkeit, weitgehend einheitlich für alle Erwachsenen, bei denen eine medikamentöse Blutdrucksenkung indiziert ist. Ausnahmen gelten für gebrechliche Patienten („frailty”), Personen ab 85 Jahren, bei begrenzter Lebenserwartung (<3 Jahre) oder bei symptomatischer orthostatischer Hypotonie. In diesen Fällen soll zu Beginn der Therapie ein individueller Zielbereich nach dem Prinzip „as low as reasonably achievable” (ALARA) definiert werden.
Fokus auf Therapie mit Fixkombinationen
Zu den wichtigsten Medikamenten zur Blutdruckkontrolle gehören Angiotensin-Converting-Enzym-(ACE-)Inhibitoren (ACE-I) und Angiotensin-Rezeptorblocker (ARB; Sartane), Calciumkanalblocker vom Dihydropyridin-Typ (CCB), Thiazid- und thiazidartige Diuretika sowie Betablocker. Dabei eignen sich Betablocker vor allem bei Patienten im Zustand nach Myokardinfarkt. Bei der medikamentösen Therapie von Bluthochdruck und Hypercholesterinämie können Fixkombinationen helfen, die Zielwerte zu erreichen, indem sie die Therapieadhärenz verbessern. Es ist bekannt, dass die Therapieadhärenz der Patienten zunehmend schlechter wird, je mehr Tabletten sie einnehmen müssen. Die ESC-Leitlinie empfiehlt bei arterieller Hypertonie grundsätzlich den Therapiebeginn mit einem Kombinationspräparat aus zwei niedrig dosierten Wirkstoffen in einer Tablette („Single-Pill-Kombination”). Dieses Konzept verfolgt zwei zentrale Ziele: 1. Überlegenheit der Kombinationstherapie: Die Kombination zweier synergistisch wirkender Substanzen in niedriger Dosierung zeigt eine bessere antihypertensive Wirksamkeit bei gleichzeitig geringerem Nebenwirkungsrisiko im Vergleich zur Hochdosierung eines Einzelwirkstoffes. 2. Verbesserung der Adhärenz: Durch die Reduktion der täglichen Tablettenanzahl senkt eine Single-Pill-Kombination die Tablettenlast, die als wesentlicher Faktor für Therapieabbrüche gilt. Studien belegen eine verbesserte Blutdruckkontrolle und eine höhere Adhärenz unter Fixkombinationen gegenüber Einzelsubstanzen. Bei den in Deutschland verfügbaren Zweifachfixkombinationen dominieren RAS-Hemmer (Renin-Angiotensin-System-Hemmstoffe) kombiniert mit Hydrochlorothiazid (HCT) oder Amlodipin. Bei den Dreifachfixkombinationen sind es im Wesentlichen Sartane (Olmesartan oder Valsartan) plus Amlodipin und HCT sowie Perindopril plus Amlodipin plus Indapamid. Eine initiale Monotherapie ist laut Leitlinie nur in ausgewählten Situationen angezeigt, etwa bei gebrechlichen Personen („frailty”), bei Menschen ≥ 85 Jahren, bei symptomatischer orthostatischer Hypotonie sowie bei Patienten mit lediglich leicht erhöhtem Blutdruck (130–139/70–79 mmHg). Substanzklassen der ersten Wahl sind:
- ACE-I,
- ARB,
- CCB,
- Thiazid- und thiazidartige Diuretika (z. B. Chlorthalidon, Indapamid).
Diese Wirkstoffklassen sind durch eine starke Evidenz hinsichtlich der Blutdrucksenkung und der Reduktion kardiovaskulärer Ereignisse belegt. Unter Monotherapie ist im Durchschnitt eine Blutdrucksenkung von ca. 10/5 mmHg zu erwarten. Eine ausdosierte Kombinationstherapie aus zwei Wirkstoffen kann eine Reduktion um etwa 20–25/10–15 mmHg erzielen. Seit einigen Jahren stehen für ausgewählte Patienten mit arterieller Hypertonie und gleichzeitiger Dyslipidämie auch Fixkombinationen zur Verfügung, die ein Antihypertensivum mit einem Lipidsenker kombinieren. Ein Beispiel hierfür ist die Kombination aus Amlodipin (einem Calciumkanalblocker) und Rosuvastatin (einem Statin). Diese Kombinationspräparate zielen darauf ab, das kardiovaskuläre Gesamtrisiko effizienter zu senken, die Therapietreue durch Reduktion der Tablettenanzahl zu verbessern und multimodale Risikofaktoren wie Hypertonie und Hyperlipidämie gleichzeitig zu adressieren. Ihr Einsatz empfiehlt sich insbesondere bei Hochrisikopatienten, bei denen sowohl eine Blutdruck- als auch eine Lipidsenkung indiziert ist.
Resistente Hypertonie
Eine resistente Hypertonie (RH) liegt definitionsgemäß vor, wenn trotz konsequenter Lebensstilinterventionen und einer antihypertensiven Dreifachkombinationstherapie, bestehend aus einem ACE-I oder ARB, einem CCB und einem Thiazid- oder thiazidartigen Diuretikum in maximaler oder maximal verträglicher Dosierung, keine ausreichende Blutdruckkontrolle im Praxissetting (<140/90 mmHg) erreicht wird. Die Diagnose muss durch häusliche Blutdruckmessung (HBPM) oder ambulantes Blutdruckmonitoring (ABPM) bestätigt werden. Eine Pseudoresistenz, etwa durch mangelnde Therapieadhärenz oder fehlerhafte Messung, ist zuvor auszuschließen. Die RH stellt keine eigenständige Entität dar, sondern vielmehr einen Marker für ein zwei- bis sechsmal höheres Risiko für kardiovaskuläre Ereignisse. Zudem ist die Prävalenz sekundärer Hypertonieformen in dieser Population erhöht. Bei Verdacht auf eine RH sollte daher eine Überweisung in ein spezialsiertes Zentrum zur Diagnosesicherung und zum Ausschluss sekundärer Ursachen erfolgen. Bei bestätigter RH besteht die Möglichkeit einer medikamentösen Therapieintensivierung. Mit einer Klasse-IIa-Empfehlung wird gleichwertig die Add-on-Therapie mit einem Mineralokortikoid-Rezeptorantagonisten (MRA) oder einem Betablocker empfohlen. Da die RH unter anderem durch eine gesteigerte Salzsensitivität und einen relativen Aldosteronexzess gekennzeichnet ist, gilt Spironolacton in einer Dosierung von 25 bis 50 mg als effektive Option zur Blutdrucksenkung. Bei etwa 6 % der Behandelten treten antiandrogene Nebenwirkungen auf; in diesen Fällen kann auf Eplerenon ausgewichen werden. Letzteres ist allerdings erst ab einer Dosierung von ≥50 mg (zweimal täglich) aufgrund seiner kürzeren Halbwertszeit blutdrucksenkend wirksam. Hinsichtlich der antihypertensiven Wirksamkeit gilt Spironolacton gegenüber Betablockern als effektiver. Falls Betablocker eingesetzt werden, sollten bevorzugt gefäßerweiternde Substanzen wie Nebivolol oder Carvedilol verwendet werden. Erst nach Ausschöpfung der oben genannten Optionen sollte der Einsatz von Hydralazin, weiteren kaliumsparenden Diuretika (z. B. Amilorid, Triamteren), zentral wirksamen Antihypertensiva oder Alphablockern erwogen werden. Aufgrund zahlreicher Nebenwirkungen bleibt Minoxidil Patienten mit therapierefraktärer Hypertonie vorbehalten, bei denen alle anderen medikamentösen Maßnahmen versagt haben.
Stellenwert von Betablockern
Betablocker werden zwar ebenfalls als Hauptsubstanzen mit guter Studienlage anerkannt, nehmen jedoch eine Sonderstellung ein: Sie sind weniger effektiv in der Schlaganfallprävention und gehen häufiger mit Nebenwirkungen und Therapieabbrüchen einher. Betablocker können gegenwärtig auf jeder Stufe eingesetzt werden, wenn eine entsprechende kardiale Indikation vorliegt oder Patientinnen eine Schwangerschaft planen. Sie gelten primär als Mittel der Wahl bei bestimmten kardialen Begleiterkrankungen wie:
- Herzinsuffizienz
- Zustand nach Myokardinfarkt
- Tachykarden Herzrhythmusstörungen (zur Frequenzkontrolle)
Bei Patienten mit Hypertonie ohne kardiale Begleiterkrankungen stellen Betablocker nicht mehr die Medikamente der ersten Wahl dar.
„Trough to peak ratio“
Beim „trough to peak ratio” (TPR), das heißt: dem Prozentsatz der maximalen Blutdrucksenkung 24 Stunden nach Einnahme des Medikamentes, bieten Sartane Vorteile im Vergleich zu den meisten ACE-Hemmern. Bis auf Perindopril (75 bis 100 %) und eventuell Lisinopril (bis zu 70 %) sind die TPR-Werte bei den meisten ACE-Hemmern zu kurz für eine einmal tägliche Gabe. Vor allem Captopril und Quinapril sind für die angestrebte einmal tägliche Gabe in der Regel nicht ausreichend; und auch für Enalapril wird zumeist eine zweimal tägliche Gabe empfohlen. Da durch Fixkombinationen die Tablettenzahl reduziert werden soll, sind zweimal tägliche Gaben kontraproduktiv. Bei Sartanen sind die TPR-Werte im Allgemeinen höher als bei ACE-Hemmern, insbesondere bei Telmisartan (≥97 %) und Candesartan (80 %). Deshalb sind diese Substanzen für die einmal tägliche Therapie besonders geeignet. Der Blutdruck wird über den gesamten Tag wirksam gesenkt. Vor allem Fixkombinationen von Sartanen und Amlodipin, ein Calciumantagonist vom Nifedipin-Typ (Dihydropyridin), bieten pharmakologische Vorteile: Bei Amlodipin liegt das TPR nahe 100 %, das heißt, der Wirkspiegel ist über den gesamten Tag konstant auf einem sehr hohen Niveau. Wird Amlodipin in niedriger Dosis gegeben (2,5 mg oder 5 mg täglich), kann eine effektive Blutdrucksenkung bei einem gleichzeitig günstigen Nebenwirkungsrisiko erzielt werden. Die Häufigkeit von Ödemen, eine häufige Nebenwirkung von Calciumantagonisten, sinkt durch die Kombination mit einem RAS-Hemmer. Unter der Therapie mit Betablockern und Thiazid ist die Inzidenz von Diabetes mellitus signifikant höher. Deshalb sollten insbesondere bei übergewichtigen Patienten mit erhöhtem Blutzucker stets RAS-Blocker plus Dihydropyridin bevorzugt werden. Diese Ergebnisse bestätigten sich in der ACCOMPLISH-Studie, in der Benazepril mit HCT oder CCB kombiniert wurde. Bei fast gleicher Blutdrucksenkung in den beiden Armen war unter Benazepril plus CCB die Rate kardiovaskulärer Ereignisse signifikant geringer.
Nutzen einer LDL-C-Reduktion
Der prognostische Nutzen einer Senkung des LDL-Cholesterins ist umfangreich dokumentiert. In einer großen Metaanalyse von 26 Studien über die Behandlung mit Statinen mit mehr als 170.000 Patienten konnte pro Reduktion des LDL-C um 1 mmol/l (39 mg/dl) über ein Jahr die kardiovaskuläre Mortalität um 20 %, die Rate schwerer kardiovaskulärer Ereignisse um 24 % und die Schlaganfallrate um 16 % verringert werden. Die Datenlage zum Nutzen von Statinen insbesondere in der Sekundärprävention ist einzigartig. Statine sind aufgrund ihrer guten Wirksamkeit und Verträglichkeit bei allen Patientengruppen Mittel der ersten Wahl zur Cholesterinsenkung. Statine hemmen die HMG-CoA-Reduktase, ein Schlüsselenzym für die Umwandlung von Acetyl-CoA zu Cholesterin. Außerdem werden unter Statinen LDL-Rezeptoren auf der Leberzelle hochreguliert. Beide Wirkungen sorgen für eine sehr effektive Senkung des LDL-C. Statine sind die einzigen lipidsenkenden Medikamente, für die bei KHK-Patienten eine Senkung der Mortalität nachgewiesen ist. Zudem liegt eine langjährige Erfahrung mit Statinen vor. Statine senken bei Patienten mit KHK die kardiovaskuläre sowie die Gesamtsterblichkeit in klinisch relevantem Ausmaß bei gleichzeitig niedrigem Risiko für schwerwiegende Nebenwirkungen. Ein systematischer Evidenzbericht mit 15 randomisierten kontrollierten Studien (n = 60.166) zeigte eine signifikante Reduktion der Gesamtsterblichkeit über eine mittlere Nachbeobachtungszeit von vier Jahren (Sterblichkeit: 9,9 % im Statin-Arm vs. 11,4 % im Placeboarm), entsprechend einer relativen Risikoreduktion von 13 % bzw. 15 verhinderten Todesfällen pro 1000 behandelten Personen. Die Mortalitätsreduktion beruhte überwiegend auf einer Senkung der kardiovaskulären Todesfälle. Zudem wurde das relative Risiko für einen nicht tödlichen Myokardinfarkt um 30 % reduziert (5,1 % vs. 7,3 %), entsprechend 22 verhinderten Ereignissen pro 1000 Patienten. Das Schlaganfallrisiko sank um 22 % (4,0 % vs. 5,2 %), entsprechend elf verhinderten Schlaganfällen pro 1000 Behandelten. Diskutiert wurde lange Zeit, ob für die Prognoseverbesserung durch Statine wirklich die LDL-C-Senkung der entscheidende Mechanismus ist oder ob pleiotrope Effekte dieser Substanzklasse eventuell von noch größerer Bedeutung sind. Inzwischen wurde durch Metaanalysen von Studien über die Behandlung mit Statinen belegt, dass kardiovaskulären Ereignissen umso effektiver vorgebeugt wird, je tiefer das LDL-C gesenkt wird.
Fokussiertes ESC-Update Lipidtherapie 2025
Die European Society of Cardiology (ESC) und die European Atherosclerosis Society (EAS) haben 2025 neue Leitlinien zur Behandlung der Dyslipidämie veröffentlicht, die die zuvor aus dem Jahr 2019 geltenden Empfehlungen ersetzen. Im Fokus steht dabei eine deutlich individualisiertere kardiovaskuläre (CV) Risikobewertung. Die Aktualisierungen beinhalten insbesondere neue Grenzwerte und eine verstärkte Nutzung bildgebender Verfahren zur Verfeinerung der Risikoeinstufung. So wird bei Patienten mit moderatem CV-Risiko der Einsatz eines Koronar-Calcium-Scores per nicht kontrastiver CT oder die Suche nach Plaques mit vaskulärem Ultraschall empfohlen, um das Risiko besser einschätzen zu können (Klasse IIa, Evidenzniveau B). Diese bildgebenden Verfahren sollen dabei helfen, die individuelle Risikoerkennung zu verbessern, da gängige Algorithmen wie SCORE2 und SCORE2-OP, die auch weiterhin die Basis der Risikobewertung bilden, vor allem bei bestimmten Subpopulationen wie jüngeren Patienten Grenzen aufweisen. Neu wurde zudem ein Schwellenwert für Lipoprotein(a) von 50 mg/dl (105 nmol/l) definiert, ab dem ein erhöhtes CV-Risiko angenommen wird und Lp(a) als unabhängiger Risikofaktor in die Betrachtung einfließen sollte. Jedoch mangelt es bislang an präzisen Handlungsempfehlungen, wie bei unterschiedlichen Lp(a)-Konzentrationen vorzugehen ist.
LDL-C-Zielwerte im Wandel
Die LDL-C-Zielwerte wurden in den vergangenen Jahren immer weiter gesenkt und richten sich nach dem kardiovaskulären Ausgangsrisiko der Patienten. Die Risikostratifizierung wurde ebenfalls überarbeitet: Das 10-Jahres-Risiko mittels SCORE2 oder SCORE2-OP wird nun in vier Stufen eingeteilt – niedrig (<2 %), moderat (2 bis <10 %), hoch (10 bis <20 %) und sehr hoch (≥ 20 %). Für Patienten mit moderatem Risiko wird die ergänzende Bildgebung empfohlen, um eine genauere Einschätzung zu erhalten und gegebenenfalls eine Therapieentscheidung besser zu fundieren. Hinsichtlich der Therapie bleiben die LDL-Cholesterinziel(Ziel)werte bei Hochrisikopatienten weiterhin streng: Ein LDL-C von <55 mg/dl gilt nach wie vor als Ziel für Patienten mit sehr hohem Risiko. Neu wurde allerdings ein noch niedrigerer Zielwert von <40 mg/dl für Patienten mit hohem Risiko vorgeschlagen – darunter Patienten mit bestätigter Atherosklerose und wiederholten vaskulären Ereignissen trotz maximal möglicher Therapie oder polyvaskulärer Erkrankung.
Lipidtherapie
Für die medikamentöse Therapie erweitert sich das Spektrum an zugelassenen Optionen. Besonders hervorzuheben ist die Empfehlung von Bempedoinsäure, die nun für Primär- und Sekundärprävention bei Patienten mit Statinintoleranz oder -kontraindikation Klasse-I-Standard ist. Zudem kann Bempedoinsäure als Ergänzung zu maximal tolerierten Statinen mit oder ohne Ezetimib verabreicht werden, um die LDL-C-Ziele zu erreichen (Klasse IIa). Bei Patienten mit homozygoter familiärer Hypercholesterinämie, bei denen trotz optimierter Behandlung keine ausreichende Senkung erzielt werden kann, steht mit Evinacumab, einem ANGPTL3-Inhibitor, eine weitere Therapieoption zur Verfügung (Klasse IIa). Für die Behandlung einer schweren Hypertriglyzeridämie bei familiärem Chylomikronämie-Syndrom wird Volanesorsen empfohlen (Klasse IIa). In der Akuttherapie nach einem Koronarsyndrom wird nun eine möglichst frühe und intensive Lipidsenkung empfohlen. Bereits hospitalisierte Patienten auf lipidsenkender Therapie sollten – wenn auf maximal tolerierter Statindosis – mit Ezetimib oder einem PCSK9-Inhibitor ergänzt werden (Klasse I). Bei vor Therapiebeginn unbehandelten Patienten wird eine Kombination aus hochdosiertem Statin und Ezetimib vor Entlassung angeraten, wobei Bempedoinsäure als Alternative zu Statinen in Betracht gezogen werden kann (Klasse IIa). Darüber hinaus finden sich spezielle Empfehlungen für Patienten mit HIV (Human Immunodeficiency Virus), bei denen Pitavastatin zur Primärprävention ab 40 Jahren empfohlen wird, basierend auf Studien mit signifikanten Risikoreduktionen. Auch onkologische Patienten mit hohem CV-Risiko unter Anthrazyklintherapie sollen eine Statinprophylaxe erwägen. Wichtig ist, dass neben der medikamentösen Therapie weiterhin Lebensstilmaßnahmen wie Ernährung, Bewegung, Diabeteskontrolle und Rauchverzicht als Grundlage bleiben. Bildgebende Verfahren können durch Einsatz künstlicher Intelligenz künftig kosteneffizienter in der Praxis verankert werden. Von der Verwendung von Nahrungsergänzungsmitteln oder Vitaminen zur CV-Risikoreduktion wird abgeraten, ebenso verliert HDL-Cholesterin an Stellenwert als protektiver Faktor in der Risikobewertung.
Kombinationstherapien im Fokus
Die Leitlinie unterstreicht zudem die Bedeutung von Kombinationstherapien: Kombinationen aus Statinen, Ezetimib, Bempedoinsäure und PCSK9-Inhibitoren ermöglichen erhebliche LDL-C-Reduktionen von bis zu 86 %. Besonders etabliert ist die Kombination von Statin mit Ezetimib, die routinemäßig zusätzlich eingesetzt werden sollte, da sie effektiv, gut verträglich und kostengünstig eine LDL-C-Senkung von rund 60 % ermöglicht.
Therapieadhärenz bei lipidsenkender Therapie
Die Zahl der täglich eingenommenen Tabletten ist für den Erfolg einer antihypertensiven oder lipidsenkenden Therapie von großer Bedeutung. Denn mit zunehmender Tablettenzahl sinkt die Therapieadhärenz. Die Patienten sollten regelmäßig nach der Tabletteneinnahme gefragt werden. Wenn man die Patienten etwas besser kennt, räumen viele ein, dass sie nicht selten eine Tablette vergessen, vor allem bei der Einnahme mittags oder abends. Die morgendliche Einnahme wird häufig besser eingehalten, da sie meist besser in die tägliche Routine eingebunden ist. Nonadhärenz ist weitverbreitet und ein häufiger Grund für einen ausbleibenden Therapieerfolg. Geschätzt wird, dass sich in westlichen Industrienationen nur etwa die Hälfte der Patienten mit chronischen Erkrankungen adhärent verhält, das heißt: die Medikamente, wie vom Arzt verordnet, einnehmen. Laut einer großen Untersuchung zur Nonadhärenz werden ein Viertel aller ärztlichen Empfehlungen nicht befolgt. Es gibt zahlreiche Faktoren, die eine Nonadhärenz begünstigen können, sowohl auf Arzt- als auch auf Patientenseite. Zum Beispiel haben die Beziehung zwischen dem Arzt und dem Patienten und die Art der Kommunikation großen Einfluss auf die Therapietreue. Fehlende Symptome, Nebenwirkungen der Medikamente und komplizierte Behandlungsschemata beeinträchtigen häufig die Adhärenz. Es gibt jedoch seitens der Patienten Unterschiede in der Resilienz sowie der Krankheits- und Behandlungseinsicht. Fixkombinationen sind geeignet, die Tablettenzahl zu reduzieren und dadurch die Therapieadhärenz zu verbessern. Eine Metaanalyse von Studien zur antihypertensiven Therapie zeigt, dass fixe Zweifachkombinationen (eine Tablette täglich) im Vergleich zu einer freien Zweierkombination (zwei Tabletten täglich) von den Patienten bevorzugt werden. Selbst beim Vergleich von nur einer Tablette gegenüber zwei Tabletten täglich war die Einnahme einer Fixkombination mit einem Anstieg der Adhärenz um 29 % verbunden. Zur Reduktion der Tablettenzahl sollte bei multimorbiden Patienten mit Polypharmazie der Medikationsplan genauer angeschaut werden. Nicht selten können Medikamente abgesetzt oder Fixkombinationen anstelle von Einzelsubstanzen verordnet werden.
Defizite bei der lipidsenkenden Therapie
Während sich die Blutdruckkontrolle in den letzten Jahrzehnten deutlich verbessert hat, gibt es bei der lipidsenkenden Therapie weiterhin größere Defizite. Nur bei 20 bis 25 % der Behandelten werden die LDL-Zielwerte erreicht. Dafür gibt es mehrere Ursachen. Erstens: Es erfolgt zu selten eine Hochdosisstatintherapie. Der LDL-Cholesterinwert liegt in Deutschland im Schnitt bei 135 bis 140 mg/dl. Das heißt, bei Hochrisikopatienten ist in der Regel eine 50%ige Senkung nötig, um auf die Zielwerte <70 mg/dl zu kommen. Das gelingt nur mit einer Hochdosisstatintherapie, also beispielsweise mit Rosuvastatin ≥10 mg oder Atorvastatin ≥30 mg. Das meistverschriebene Statin in Deutschland ist allerdings Simvastatin 20 mg, das deutlich weniger effizient ist. Bei der Wahl des Statins sollten einige Punkte berücksichtigt werden. Neben der Wirksamkeit und Verträglichkeit können weitere Eigenschaften wie Lipophilie, Halbwertszeit, selektive Wirkung und Metabolisierung einen relevanten Unterschied ausmachen:
- Das Enzym HMG-CoA-Reduktase wird von den einzelnen Substanzen unterschiedlich stark gehemmt. Rosuvastatin hat den niedrigsten IC50-Wert, das heißt: die höchste Potenz. Rosuvastatin und Pravastatin wirken am selektivsten in der Leberzelle.
- Rosuvastatin, Fluvastatin und Pravastatin werden nicht über das Cytochrom P450 3A4 metabolisiert, dem häufigsten Abbauweg von Medikamenten, das bedeutet: Das Risiko für Arzneimittelinteraktionen ist bei diesen Statinen geringer.
- Rosuvastatin und Atorvastatin haben lange Halbwertszeiten und können morgens eingenommen werden, was für die Adhärenz günstiger ist. Andere Statine müssen abends gegeben werden.
- Pravastatin und Rosuvastatin sind besonders lipophil, was für die Resorption und Bioverfügbarkeit günstig ist.
Insgesamt bietet Rosuvastatin die meisten Vorteile: Die Substanz hat die höchste Potenz, eine lange Halbwertszeit, sie wirkt hepatoselektiv und hat einen unkomplizierten Abbaumechanismus.
Dosis-Wirkungs-Beziehung und Potenz von Statinen
Ein weiterer Grund für die in der Praxis häufig unzureichende Wirksamkeit von Statinen ist die nonlineare Dosis-Wirkungs-Beziehung. Jede Verdoppelung der Dosis führt im Mittel lediglich zu einer zusätzlichen Reduktion des LDL-C von rund 6 %. Eine Erhöhung der Simvastatin-Dosis von 20 mg auf 40 mg ist daher häufig nicht zielführend. Sinnvoller ist hingegen ein Wechsel von Simvastatin auf ein potenteres Statin. Zu beachten ist zudem, dass die Nebenwirkungen von Statinen dosisabhängig sind. Das betrifft sowohl die Erhöhung der Transaminasen, die aber in der Praxis selten das Problem sind, als auch die prodiabetogene Wirkung sowie das Auftreten von Muskelschmerzen. Es überwiegt aber klar der Nutzen von Statinen. Wenn 255 Patienten auf ein Statin eingestellt werden, wird dadurch bei einem Patienten ein Diabetes mellitus ausgelöst, gleichzeitig werden fünf Patienten vor einem Herzinfarkt, einem Schlaganfall oder einem kardiovaskulären Tod bewahrt. Muskelschmerzen, von den Patienten oft auch als Gelenkschmerzen beschrieben, werden von etwa 20 bis 40 % der Patienten unter einer Statintherapie geschildert. Es ist aufwendig, Muskelschmerzen als tatsächliche Nebenwirkung von Statinen zu verifizieren. Es sollte mit der Therapie pausiert und beurteilt werden, ob sich die Schmerzen bessern. Genauso wichtig ist dann die Re-Exposition, zunächst in niedriger Dosis. Es lohnt sich, die minimal tolerierte Statindosis aufzutitrieren. Auch ein Wechsel des Statins kann die Verträglichkeit der Therapie verbessern.
Fallbeispiel
Eine 66-jährige Patientin wird seit zehn Jahren wegen einer primären arteriellen Hypertonie behandelt. Sie hat außerdem eine linksventrikuläre Hypertrophie. Der Kreatininwert ist normal. Die Patientin nimmt aktuell elf Tabletten ein, darunter Losartan (zweimal täglich), Minoxidil (zweimal täglich), Nifedipin retard (zweimal täglich), Bisoprolol (zweimal eine halbe Tablette täglich), Torasemid (zweimal täglich) und Simvastatin (einmal täglich). Der Blutdruck lag unter dieser Therapie im Mittel bei 166/96 mmHg. Bei dieser Patientin könnte die Tablettenzahl deutlich reduziert werden. Die folgenden Therapieoptionen sind denkbar:
- Minoxidil könnte abgesetzt werden.
- Bisoprolol könnte einmal täglich gegeben werden.
- Nifedipin, ein älterer CCB, könnte durch ein einmal täglich zu verabreichendes Präparat ersetzt werden.
- Das Gleiche gilt für Losartan.
- Anstelle von Simvastatin könnte ein potenteres Statin eingesetzt werden. Außerdem zu beachten: Simvastatin darf in Kombination mit etlichen CCB, insbesondere Amlodipin, nur bis zu einer Dosis von 20 mg gegeben werden, da es über den gleichen Weg metabolisiert wird und beispielsweise Amlodipin den Abbau von Simvastatin hemmt, sodass das Risiko von Nebenwirkungen wie Myopathien erhöht ist.
So wurde die Therapie vereinfacht: Die Patientin wurde von Losartan und Nifedipin auf die Fixkombination Candesartan (16 mg)/Amlodipin (5 mg) umgestellt. Anstelle von Simvastatin wurde die Fixkombination Rosuvastatin (20 mg)/Amlodipin (5 mg) eingesetzt und auf diese Weise Amlodipin maximal auf 10 mg aufdosiert. Bisoprolol wurde wieder einmal täglich verabreicht, Minoxidil abgesetzt. Die Einnahme von Torasemid 5 mg wurde der Patientin morgens empfohlen, wenn sie nicht aus dem Haus geht bzw. dann, wenn sie zurückkommt. Durch diese Vereinfachungen konnte die Tablettenzahl von elf auf nur noch vier Tabletten täglich reduziert werden. Gleichzeitig konnte der Blutdruck auf einen Mittelwert von 132/85 mmHg gesenkt werden.
Lipidsenkende Kombinationstherapie
Die zielwertadaptierte Therapie der Hypercholesterinämie basiert in erster Linie auf der Verabreichung von Statinen. Dabei werden hochpotente Präparate in der maximal zugelassenen Dosis verwendet, um die bestmögliche Wirkung zu erzielen. Falls es nicht gelingt, den angestrebten Zielwert mit den Statinen zu erreichen, sollte eine Kombinationstherapie mit Ezetimib in Erwägung gezogen werden. Sollte auch dies nicht ausreichend sein, kann eine Kombination mit einem Gallesäurebinder oder mit Bempedoinsäure in Betracht gezogen werden. Bei Patienten mit bestehenden kardiovaskulären Erkrankungen und/oder familiärer Hypercholesterinämie sollte die Verabreichung eines PCSK9-Inhibitors evaluiert werden. Nach einem akuten Koronarsyndrom wird unabhängig vom Ausgangswert des LDL-Cholesterins eine hochpotente Statintherapie für alle Patienten empfohlen. Ezetimib hemmt selektiv im Darm den Rezeptor Niemann-Pick C1-like protein 1 (NPC1L1), über den aus dem Darm Cholesterin aufgenommen wird – sowohl Nahrungs- als auch biliäres Cholesterin. Gegenregulatorisch kommt es allerdings zu einer Erhöhung der Cholesterinbiosynthese in der Leber. Aus diesem Grund ist Ezetimib ein gut geeigneter Kombinationspartner für Statine. Das Statin hemmt die Cholesterinbiosynthese – gegenregulatorisch kommt es zu einer Erhöhung der Cholesterinresorption aus dem Darm, die durch Ezetimib gehemmt wird, und umgekehrt. Ezetimib ist gut verträglich und in der Monotherapie mit einer geringen Nebenwirkungsrate assoziiert. Ezetimib wirkt sehr zuverlässig. Unabhängig von den Ausgangswerten wird das LDL-C in Kombination mit einem Statin um zusätzliche 25 % gesenkt. Insofern unterscheidet sich die Behandlung mit Ezetimib deutlich von einer alleinigen Statingabe, auf die Patienten sehr variabel ansprechen können. In der IMPROVE-IT-Studie wurde belegt, dass durch die zusätzliche LDL-C-Senkung mit Ezetimib die Prognose der Patienten im Vergleich zu einer Statinmonotherapie verbessert wird: Die Rate für kardiovaskuläre Komplikationen (kardiovaskulärer Tod, nicht tödlicher Herzinfarkt, Hospitalisierung wegen instabiler Angina, Koronarrevaskularisation) und nicht tödliche Schlaganfälle war nach sieben Jahren relativ um 6,4 % und absolut um 2 % reduziert. Neben ASS (nur in der Sekundärprävention) sind Lipidsenker (Statine/Ezetimib) und Antihypertensiva (bevorzugt RAS- und Calciumkanalblocker) die wichtigsten prognoseverbessernden Medikamente in der Primär- und Sekundärprävention. Werden mehrere Antihypertensiva oder Lipidsenker eingesetzt, sollten möglichst die Vorteile von Fixkombinationen genutzt und z. B. zwei oder drei Antihypertensiva oder auch Statin plus Ezetimib in einer Tablette verordnet werden. Bei Patienten, bei denen sowohl Blutdruck als auch LDL-C gesenkt werden sollen, bietet sich der Einsatz neuer Fixkombinationen mit ein oder zwei Antihypertensiva plus Statin an. Blutdruck und LDL-C sind die beiden großen Targets in der kardiovaskulären Prophylaxe. Die Fixkombination mit beiden Ansätzen ermöglicht eine umfassende Gefäßprotektion.
Fazit
- Bluthochdruck ist weiterhin weltweit der bedeutendste Morbiditäts- und Mortalitätsrisikofaktor.
- Um rasch den Zielblutdruck zu erreichen, werden in den aktuellen Leitlinien Zweifachkombinationen bereits in der Initialphase der Hochdrucktherapie empfohlen.
- Fixkombinationen sind eine wichtige Strategie, um die bei Patienten mit chronischen Erkrankungen, insbesondere bei fehlenden Symptomen, oft schlechte Therapieadhärenz zu verbessern.
- Bei der Lipidtherapie ist die effektive LDL-C-Senkung die entscheidende Maßnahme zur kardiovaskulären Protektion.
- Statine sind Mittel der ersten Wahl zur LDL-C-Senkung; eine Monotherapie reicht jedoch nicht immer aus.
- Mit Rosuvastatin/Atorvastatin plus Ezetimib können bei den meisten Patienten die LDL-C-Zielwerte erreicht werden.
- Zudem können für die Kombinationstherapie der Dyslipidämie PCSK9-Inhibitoren sinnvoll sein.
Bildnachweis
Leonid - Adobe Stock Photo